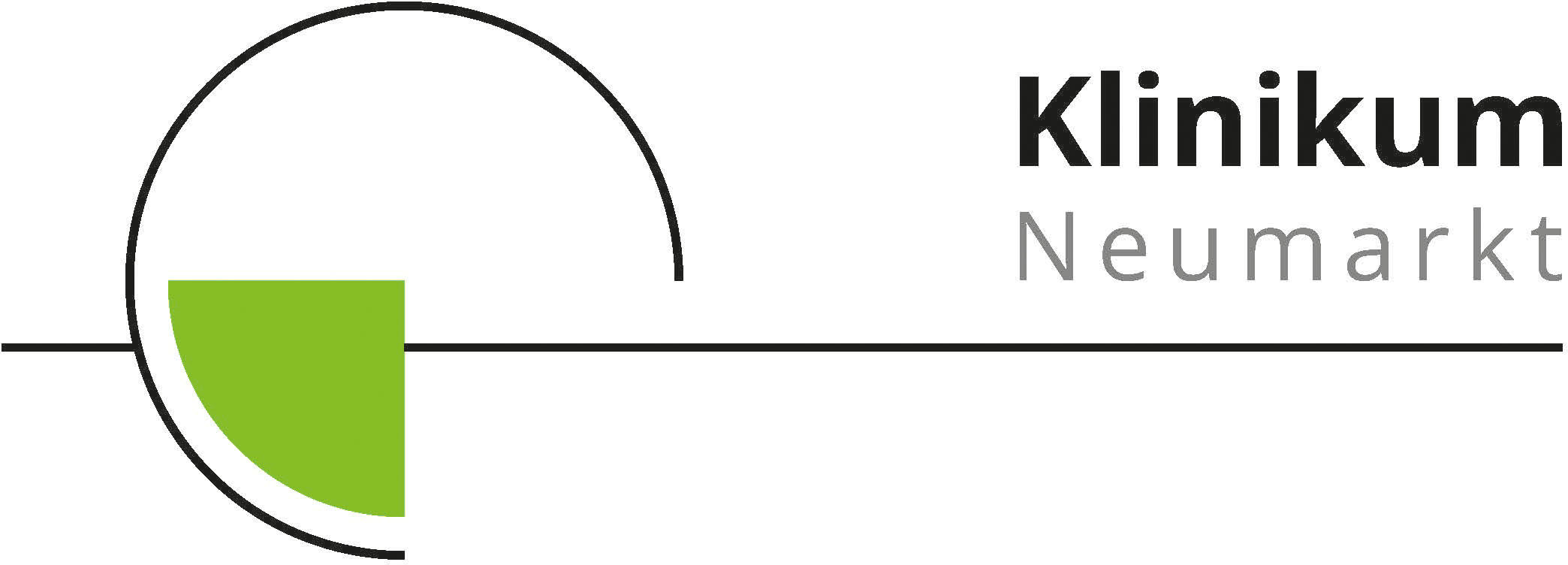Mit zunehmendem Nierenversagen entwickelt sich das Krankheitsbild der Urämie. Bei der Urämie handelt es sich um eine endogene Vergiftung, die alle Organsysteme betrifft. Die Symptome beginnen unspezifisch mit einer allgemeinen Leistungsminderung.
Symptome
Folgende Symptome können auftreten:
- Appetitlosigkeit, Übelkeit, Erbrechen
- Atemnot, Lungenödem, Überwässerung
- Hypertonie
- Bewusstseins- und Gedächtnisstörungen
- Juckreiz
- Herzbeutelentzündung, Herzrhythmusstörungen
- Knochenschmerzen, pathologische Frakturen
- Anämie, Blutungsneigung
Nierenersatztherapie (Dialyse)
Wichtig ist die rechtzeitige Einleitung einer Nierenersatztherapie (Dialyse). Bei der Dialyse handelt es sich um ein Blutreinigungsverfahren, das die lebenswichtigen Funktionen der Nieren übernimmt.
Ziel dieser Nierenersatztherapie ist die Entfernung von überschüssigem Wasser und harnpflichtigen Substanzen (Giftstoffen) sowie die Korrektur von Störungen im Elektrolyt- und Säurebasenhaushalt.
In Deutschland wird die Zahl der Dialysepatienten auf etwa 90.000 geschätzt, von denen ca. 93 % mit der Hämodialyse und 7 % mit der Peritonealdialyse behandelt werden. Diese beiden Verfahren sind in ihrer Effektivität vergleichbar und werden in Abstimmung mit Patienten und Angehörigen ausgewählt.
Behandlungsverfahren
Hämodialyse
Dieses Verfahren wird in Deutschland am häufigsten angewandt. Das Blut wird maschinell außerhalb des Körpers über ein Schlauchsystem zu einem Filter geführt, in dem sich sehr viele feine Kapillaren befinden, die von einer Spülflüssigkeit (Dialysat) umspült werden. Grundprinzip ist die Diffusion. Über eine halbdurchlässige Membran diffundieren harnpflichtige Stoffe (Giftstoffe), einem Konzentrationsgradienten folgend, aus dem Blut in die Dialysatflüssigkeit. Außerdem kann durch ein physikalisches Druckgefälle überschüssiges Wasser maschinell aus dem Körper entzogen werden. Blut und Dialysat strömen im Kapillardialysator in entgegengesetzten Richtungen, um ein Konzentrationsgefälle aufrecht zu erhalten. Nach der Filterpassage wird das gereinigte Blut über das Schlauchsystem wieder in den Körper zurückgeführt.
Zur Vorbereitung auf die Hämodialyse wird den Patienten eine arteriovenöse Fistel am Unterarm angelegt. Hierdurch entsteht ein leicht punktabler Gefäßzugang (Shunt). Vor einer Shuntanlage dürfen am betreffenden Unterarm keine Blutentnahmen erfolgen, um die Gefäße zu schonen. Eine Alternative zum Shunt ist ein Vorhofkatheter, der bei notwendiger sofortiger Dialyseeinleitung oder schlechten Gefäßverhältnissen über eine große Vene am Hals oder unter dem Schlüsselbein angelegt wird.
Diese Katheteranlage wird in örtlicher Betäubung ohne Vollnarkose durchgeführt und ist daher besonders schonend. Die Hämodialyse wird überwiegend als Zentrumsdialyse im KfH-Nierenzentrum durchgeführt, kann aber auch als Heimdialyse zu Hause betrieben werden. Eine Hämodialysesitzung wird in der Regel
3 x pro Woche im Dialysezentrum durchgeführt und dauert 4 bis 5 Stunden.
Vorteile
- Die Behandlung erfolgt im Dialysezentrum unter ärztlicher Aufsicht.
- Regelmäßiger Kontakt zu geschultem Fachpersonal und Kontakt zu anderen Dialysepatienten
- Durchführbarkeit auch bei geringer Restfunktion der Nieren
Nachteile
- Regelmäßige Termine im Dialysezentrum müssen wahrgenommen werden.
- Ansammlung von harnpflichtigen Stoffen (Giftstoffen) und überschüssigem Wasser zwischen den Dialysesitzungen
Peritonealdialyse
Bei der Peritonealdialyse wird das Bauchfell (Peritoneum) als natürliche Filtermembran genutzt. Das Bauchfell kleidet die gesamte Bauchhöhle aus und überzieht einen großen Teil der inneren Organe. Es hat eine Fläche von 1-2 m², ist sehr gut durchblutet und eignet sich daher als Austauschmembran für die Dialyse.
Zur Behandlung wird eine Dialyselösung über einen in den Bauchraum implantierten Katheter in die Bauchhöhle gefüllt. Die harnpflichtigen Stoffe (Giftstoffe) treten aus den kleinen Blutgefäßen des Bauchfells über in die Dialyselösung. Zur Entfernung von überschüssigem Wasser wird Dialyselösung mit unterschiedlichen Glucosekonzentrationen verwendet. Dadurch kann Wasser in die Bauchhöhle wandern und abgelassen werden. Die Dialyselösung wird nach 4 bis 6 Stunden aus der Bauchhöhle abgelassen und durch eine frische Lösung ersetzt. Ein solcher Beutelwechsel dauert etwa 20 Minuten und wird selbstständig von den Patienten zu Hause durchgeführt. Dafür ist zuvor eine ausführliche Schulung im Dialysezentrum notwendig.
Man unterscheidet zwei verschiedene Formen der Peritonealdialyse:
Dabei wechselt der Patient ca. 4 x täglich die Dialyselösung selbst manuell aus. Über den Katheter werden meistens 2 l Dialyselösung in die Bauchhöhle gefüllt und verbleiben dort für 4-6 Stunden. Danach wird das mit Giftstoffen angereicherte Dialysat in einen Beutel abgelassen und neues Dialysat nachgefüllt.
Hierbei wird die Peritonealdialyse nachts automatisiert durch eine Maschine (Cycler) durchgeführt. Es werden mehrere Lösungswechsel mit kürzeren Verweilzeiten im Bauch vorgenommen. Auf diese Weise werden 10-15 l Dialyselösung maschinell ausgetauscht. Am folgenden Morgen kann eine erneute Dialysatfüllung erfolgen, die tagsüber in der Bauchhöhle verbleibt. Erfolgt keine morgendliche Füllung, wird das Verfahren als nächtlich-intermittierende Peritonealdialyse (NIPD) bezeichnet.
Vorteile
- Unabhängigkeit vom Dialysezentrum
- Stärkere Eigenverantwortung und Mitgestaltung der eigenen Behandlung
- Kontinuierliche Entfernung von überschüssigem Wasser und harnpflichtigen Stoffen (Giftstoffen) aus dem Körper
- Geringere Kreislaufbelastung und weniger Ernährungsvorschriften
Nachteile
- Bei geringer Restfunktion der Nieren schlecht durchführbar
- Nach einigen Jahren nachlassende Effektivität durch Veränderungen des Bauchfells
Sprechstunden & Ambulanzen
- Nephrologische Ambulanz im KfH-Nierenzentrum
Montag bis Freitag 8-13 Uhr und nach Vereinbarung - Dialysezeiten im KfH-Nierenzentrum
Montag, Mittwoch, Freitag 7-23 Uhr
Dienstag, Donnerstag, Samstag 7-19 Uhr
Gut zu wissen
- Eine tägliche Eiweißaufnahme von 0,6 bis 1 g/kg Körpergewicht wird empfohlen.
- Dabei sollen pflanzliche Eiweiße mit hoher biologischer Wertigkeit bevorzugt werden.
- Zu viel Eiweiß, Kalium, Natrium und Phosphat sollten vermieden werden. Hierzu gehören Fertigprodukte, die häufig phosphathaltige Zusätze enthalten.
- Die Eiweißzufuhr sollte zu 2/3 aus pflanzlichem und nur zu einem Drittel aus tierischem Eiweiß bestehen.
- Kaliumreiche Nahrungsmittel wie Bananen, Hülsenfrüchte, Trockenobst, Säfte, Nüsse sowie Fertigprodukte wie Chips und Kartoffelbrei sollten reduziert werden.
- Kochsalz sollte ebenfalls reduziert werden.
- Dialysepatienten benötigen mehr Eiweiß als gesunde Menschen, da es während der Hämo- und Peritonealdialyse zu einem Verlust von Aminosäuren kommt.
- Peritonealdialysepatienten benötigen zusätzliches Eiweiß.
- Phosphatreiche Lebensmittel wie Schmelzkäse, Nüsse, Kakao, Bier sowie Cola sollten vermieden werden. Erhöhte Phosphatwerte führen zu Folgeschäden wie Verkalkungen in den Blutgefäßen und Knochenschäden. Dialysepatienten erhalten daher Phosphatbinder, die sie zu den phosphathaltigen Mahlzeiten einnehmen.
- Da Kalium über die Nieren ausgeschieden wird, kommt es bei Nierenerkrankungen zu Störungen im Kaliumhaushalt. Kalium ist vor allem in Obst, Gemüse, Kartoffeln, Nüssen, Trockenfrüchten und Säften enthalten. Diese Lebensmittel sollten reduziert werden.
- Die tägliche Trinkmenge richtet sich nach der Nierenrestfunktion und beträgt ungefähr 500 ml mehr als die tägliche Urinausscheidung (Diurese).
- Bei Wassereinlagerungen (Ödemen) und erhöhtem Blutdruck sollte eine Einschränkung bei der Kochsalzzufuhr beachtet werden.
- Hämodialysepatienten benötigen meist einen Zusatz an wasserlöslichen Vitaminen.