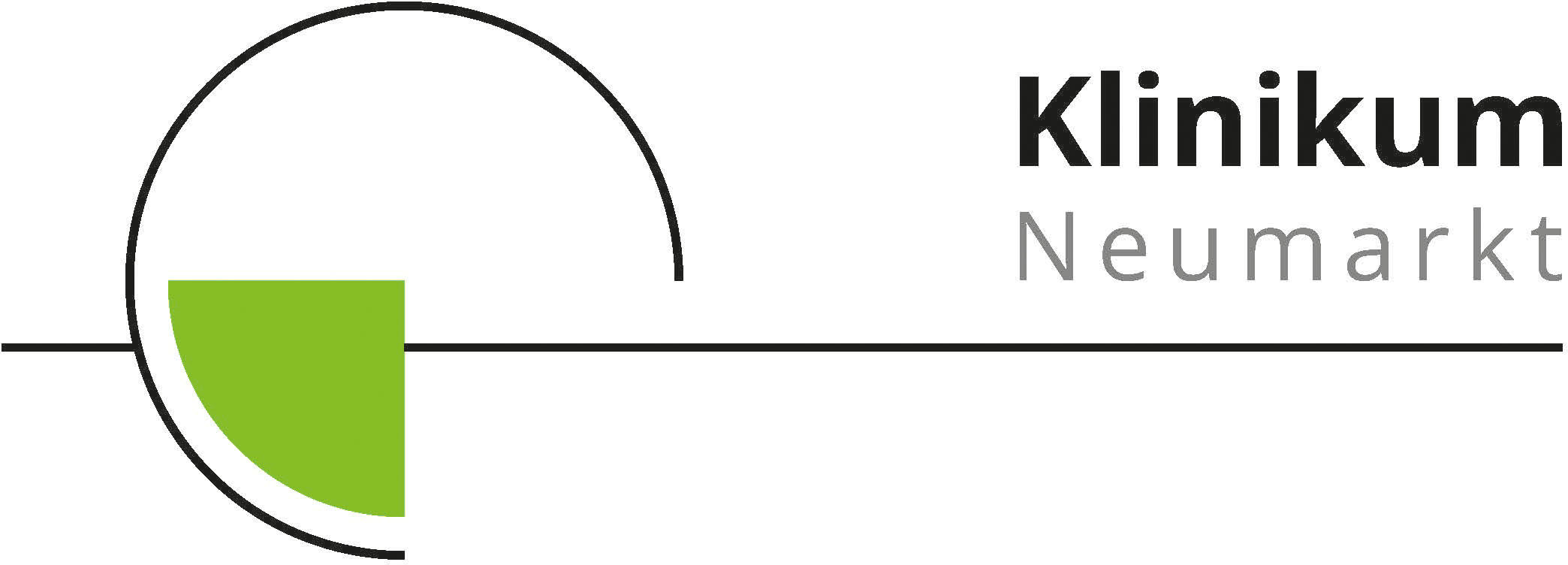Die Nierentransplantation stellt hinsichtlich der Lebensqualität das beste Nierenersatzverfahren dar. Die Lebenserwartung von transplantierten Patienten ist im Vergleich zu Wartelistenpatienten an der Dialyse höher. Daher wird bei allen Patienten, bei denen keine absolute Kontraindikation besteht, die Möglichkeit einer Nierentransplantation überprüft. Nach Aufklärung hat der Patient die Möglichkeit, sich zwischen Transplantation und einem Dialyseverfahren zu entscheiden.
Transplantation einer Niere von einem Verstorbenen
Bei der Transplantation wird zwischen Lebendspende und der Übertragung einer Niere von einem Verstorbenen unterschieden. Die Vermittlung der Niere eines Verstorbenen erfolgt in den Eurotransplant-Ländern nach einem Punktesystem, das die Gewebeverträglichkeit, Wartezeit und Distanz zwischen Spender- und Empfängerzentrum berücksichtigt.
Die Vorbereitung und Nachbetreuung geeigneter Patienten erfolgt in der Klinik für Nephrologie sowie am KfH-Nierenzentrum Neumarkt in Kooperation mit den universitären Transplantationszentren Erlangen und Regensburg. In Deutschland stehen etwa 6.600 Patientinnen und Patienten auf der Warteliste für eine Nierentransplantation. Durchschnittlich werden aber nur ca. 1.900 Nierentransplantationen pro Jahr vorgenommen.
Lebendspende
Bei einer Lebendspende erfolgen intensive Untersuchungen des Spenders, um das Risiko für den Spender, aber auch für den Empfänger möglichst gering zu halten. Eine psychologische Untersuchung ist zusätzlich notwendig, um die Freiwilligkeit und mögliche psychische Folgen der Spende zu überprüfen.
Nierentransplantation
Die Nierentransplantation erfolgt außerhalb der Bauchhöhle ins kleine Becken, wobei die Gefäße des Transplantats an die Beckengefäße des Empfängers angeschlossen werden. Der Harnleiter des Transplantats wird in die Blase des Empfängers implantiert. In der ersten Phase nach Transplantation können chirurgische Komplikationen wie Blutungen, Urinlecks, Engstellen an den Gefäßnähten oder Flüssigkeitsansammlungen entstehen. Außerdem kann es zu einer vorübergehenden Funktionsstörung des Transplantats kommen.
Um eine Abstoßung des transplantierten Organs zu verhindern, ist eine lebenslange Unterdrückung der Immunantwort (Immunsuppression) erforderlich. Diese beginnt mit einer Antikörpertherapie, sowie einer Kombination verschiedener immunsuppressiver Medikamente, in der Regel eines Calcineurininhibitors, eines Mycophenolat-Derivates, und Steroiden (Cortison). Diese Therapie wird der individuellen Situation angepasst.
Langfristig kommt es durch antikörpervermittelte Abstoßungsreaktionen zu einer Verschlechterung der Transplantatfunktion, so dass nach 10 Jahren noch etwa 60 bis 70 % der Nierentransplantate funktionieren. Durch das unterdrückte Immunsystem kommt es vor allem im ersten halben Jahr nach Transplantation zu gehäuften spezifischen Infektionen z.B. mit Viren der Herpesgruppe, Pilzinfektionen oder Pneumocystisinfektionen, deren Risiko durch Prophylaxen vermindert werden kann.
Die medikamentöse Immunsuppression erhöht das Tumorrisiko. Auch bei Transplantierten stellen kardiovaskuläre Erkrankungen die häufigste Todesursache dar. Langzeitkomplikationen wie Störungen im Knochenstoffwechsel, Hauterkrankungen oder beispielsweise Erkrankungen im Bereich der Augen durch Linsentrübung und erhöhtem Augeninnendruck müssen regelmäßig überwacht werden.
Nierentransplantierte werden in definierten Zeitabständen regelmäßig in unserer Transplantationssprechstunde betreut.
Hierzu gehören:
- Laboruntersuchungen zur Transplantatfunktion
- die Überwachung der therapeutischen Zielspiegel der Immunsuppressiva sowie
- spezielle farbduplexsonografische Untersuchungen des Nierentransplantates einschließlich der Durchblutungsmessung (Angiodynografie).