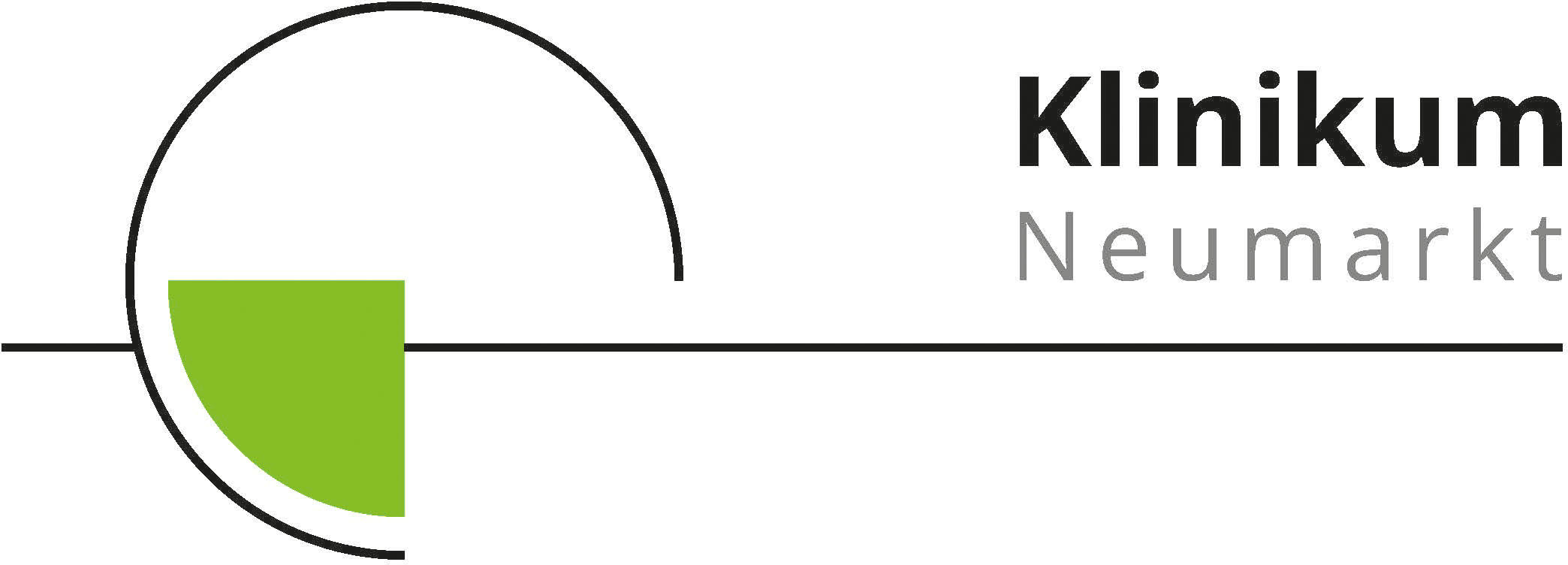Eine Durchblutungsstörung der Beine, die sogenannte periphere arterielle Verschlußkrankheit (pAVK), auch Schaufensterkrankheit genannt, kann akut oder chronisch auftreten. Akut durch plötzlich aufgetretene Verschlüsse an den Gefäßen wie zum Beispiel durch eine Embolie bei Herzrhythmusstörungen oder als Folge von Kathetermaßnahmen über die Gefäße. Chronisch wird sie am häufigsten durch die sogenannte Arteriosklerose verursacht. Die Durchblutungsstörungen der Beine, ob abdominell, iliacal, femoral, crural oder pedal, können operativ therapiert werden oder auch im Rahmen einer Hybridoperation, einer Kombination aus operativer und endovaskulärer Therapie, behandelt werden.
Typische Symptome
Durchblutungsstörungen der Beine fallen meist durch Schmerzen im Bein auf. Bei schweren und vor allem akuten Gefäßverschlüssen kann im schlimmsten Fall das gesamte Gefühlsvermögen und die Bewegungsfähigkeit des Beins verloren gehen. In solchen Fällen handelt es sich um einen akuten Notfall und eine sofortige weitere gefäßchirurgische Behandlung ist erforderlich.
Bei chronischen Verschlussprozessen kommt es meist zunächst zu Schmerzen bei Belastung der Muskulatur der Beine. Dies wird auch häufig als Schaufensterkrankheit bezeichnet, da Betroffene nach bestimmten Gehstrecken zum Pausieren stehen bleiben müssen und dann erst wieder weitergehen können. Schreitet die Erkrankung fort, treten bereits im Ruhezustand Schmerzen auf oder es entstehen nicht abheilende Wunden oder offene Stellen, meist am Fuß.
Stadien der pAVK
Es bestehen nachweisbare Gefäßveränderungen, ohne dass der Patient Beschwerden bemerkt. Ein Eingriff erfolgt hier nur in speziellen Ausnahmefällen.
Die Gefäßveränderungen verursachen Beschwerden beim Gehen (z.B. das Gefühl eines Muskelkaters oder einen brennenden Schmerz in der Wade, der zum Stehenbleiben zwingt). Dieses Stadium wird auch als „Schaufensterkrankheit“ bezeichnet. Stadium IIa bezeichnet eine schmerzfreie Gehstrecke von mehr als 200 Metern, beim Stadium IIb beträgt die schmerzfreie Gehstrecke weniger als 200 Meter.
Die Durchblutungsstörung ist hier so ausgeprägt, dass bereits ohne Belastung Schmerzen in den Beinen auftreten, vor allem im Liegen und in der Nacht. Dies bezeichnet man als Ruheschmerzen. Die Extremität ist kritisch durchblutungsgestört.
Durch die ausgeprägte Durchblutungsstörung ist es zur Entstehung von Wunden oder zum Absterben von Gewebe, meist im Bereich des Fußes (Zehen, Ferse oder Knöchel) gekommen. Nach Durchblutungsverbesserung ist bei oberflächlicher Gewebsschädigung ein folgenloses Abheilen möglich. Ist der Gewebsverlust weit fortgeschritten, müssen die betroffenen Teile des Fußes (z.B. Zehen) amputiert werden, auch wenn die Durchblutung wiederhergestellt wurde.
Diagnose
- Wichtig ist zunächst die ausführliche Befragung und klinische Untersuchung des Patienten (z.B. Pulsstatus, Inspektion).
- Danach erfolgt ein Gefäßultraschall (farbkodierte Duplexsonographie) zur Befunderhebung.
- Eine radiologische Schnittbilddiagnostik (CT- oder MR-Angiographie) ist häufig sinnvoll zur weiterführenden genaueren Diagnostik und zur Planung der Art der Behandlung. Hier kann zum Beispiel entschieden werden, ob eine Gefäßaufdehnung, gegebenenfalls mit Stent, möglich und auch sinnvoll ist. Oder ob ein Bypass angelegt werden muss.
- Dann kann die Anschlusshöhe des Bypasses bestimmt werden. Auch der Durchmesser und die Länge eines Stents kann mit der MR- oder CT-Angiographie vorab berechnet werden. Diese ist hierzu der aktuelle medizinische Standard. Rein diagnostische Katheteruntersuchungen werden nur noch in Spezialfällen benötigt.
- Bei offenen Stellen an den Gliedmaßen erfolgt meist zusätzlich eine Röntgenaufnahme des Knochens im betroffenen Bereich zur Beurteilung einer möglichen Knochenschädigung.
Therapie
Die Behandlung der pAVK kann entweder offen operativ oder endovaskulär, d.h. mittels Katheterverfahren oder in Kombination der Verfahren (Hybrid-OP) erfolgen.
Wichtig für die geeignete Wahl der Behandlung sind unter anderem:
- Länge und Lage der Gefäßengstelle oder des Gefäßverschlusses (Bewegungssegment / Gefäßaufteilungsstelle)
- der Durchmesser des zu behandelnden Gefäßabschnittes
- Alter und Begleiterkrankungen des Patienten
- Risikoeinschätzung
- prognostische Beurteilung des beim Patienten vorliegenden Krankheitsverlaufs
Eine offene Operation verfolgt folgende Ziele:
- Thrombendarterektomie
„Herausschälen“ von atherosklerotischen Ablagerungen aus dem Gefäß - Bypassanlage
Überbrückung von Verengungen oder Verschlüssen mittels Bypass-Anlage mit körpereigener Vene oder Kunststoff. Bei einer Bypassanlage wird Blut von einem gut durchbluteten Gefäß zu einer schlecht durchbluteten Region transportiert. Eine Bypassanlage erfolgt immer dann, wenn eine operative Gefäßausschälung bzw. ein Aufdehnen ggf. mit Stent voraussichtlich oder nachweislich nicht ausreicht, um das Durchblutungsproblem beim Patienten sinnvoll zu behandeln.
Je nach individuellem Erkrankungsbild kann der Gefäßchirurg auch sogenannte Hybridverfahren (Hybrid-Operation) durchführen. Dabei wird in einem Eingriff eine offene Operation mit endovaskulären Interventionen (Kathetertechnik mit Ballonaufdehnung/Stent) kombiniert.
Es stehen verschiedene interventionelle/endovaskuläre, minimalinvasive Methoden zur Verfügung (Kathetertechnik mit Ballonaufdehnung/Stent). Dabei wird über eine Punktion der Schlagader in örtlicher Betäubung eine Gefäßdarstellung mit Kontrastmittel in Röntgendarstellung durchgeführt.
Therapieoptionen
- Die Behandlung der Gefäßengstellen oder Verschlüsse erfolgt durch Aufdehnen (Angioplastie, Ballondilatation) des betroffenen Gefäßabschnitts,
meist mit Ballons, die mit bestimmten Medikamenten beschichtet sind und ggfls. mit einer zusätzlichen Einlage einer Gefäßstütze, eines sogenannten Stents. - Bei noch nicht lange bestehenden Gefäßverschlüssen kann auch eine Auflösung von abgelagerten Blutgerinnseln (Lyse) mit ggfls. zusätzlicher Aufdehnung und Stent durchgeführt werden.
- Interventionell kann auch eine weitgehende Entfernung der Ablagerungen im Gefäß z.B. mittels Rotationsarterektomie durchgeführt werden.
- Schwer verkalkte Gefäße können mit speziellen Ballonkathetern behandelt werden, die den Kalk „zertrümmern“ können (sogenannte Lithoplastie).
Für jeden einzelnen Patienten erfolgt eine individuelle Abwägung, welche Therapieform für ihn ideal ist.